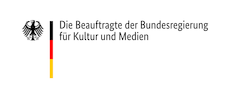La Mandorle
Victoire Delnatte Oboe
Clotilde Sors Violin
Camille Sors Violoncello
Elodie Brzustowski Theorbe, Baroque guitar
Die Lorbeeren werden abgeschnitten
Michael Schäfer
Die folgenden Erläuterungen gründen sich in erster Linie auf Informationen, die das Ensemble La Mandorle zu seinen Wettbewerbsprogrammen bei seiner Bewerbung abgegeben hat:
Unser Programm beginnt mit einem Medley von Arien aus der weltlichen Kantate Apollo e Dafne. Diese 1710 vom jungen Händel geschriebene Kantate erzählt die tragische Geschichte von Apollo, dem Gott der Musik, und Dafne, einer von ihm verfolgten Nymphe. Um Apollos Verfolgung zu entgehen, verwandelt sie sich in einen Baum – ein ultimativer Akt des Widerstands. Der Lorbeer ist ein Symbol des Triumphs – sicherlich für Apollo – aber auch für Dafne, die in ihrer Verwandlung Unsterblichkeit findet, eine starke Symbolik.
Wir fahren fort mit der Sonate g-Moll von Elisabeth Jacquet de la Guerre, einer der ersten Frauen, die in einer männerdominierten Musikwelt Anerkennung erlangte. Zu ihrer Zeit blieben ihr die Lorbeeren – die ihr gebührenden Ehrungen und Anerkennungen – jedoch oft aufgrund ihres Geschlechts verwehrt. Die Brillanz ihrer Musik lädt uns ein, über die Lorbeeren nachzudenken, die ihr versagt wurden.
Der junge französische Gitarrist und Komponist Lucius Arkmann greift in Fin de soirée chez Madame de Pompadour (Ende der Soirée bei Madame de Pompadour) die Feierlichkeit des Hofes von Versailles auf und verleiht ihr seine eigene Energie. Er versucht jedoch nicht, die Figur der Mme de Pompadour mit dem Prunk des Hofes zu feiern. Im Gegenteil, die Favoritin Ludwigs des XV. strahlt durch den Einsatz von Techno, einem mit dem Underground verbundenen Musikgenre, eine Form ungehemmter Modernität aus. Statt eine Trophäe der Bewunderung zu sein, wird der Lorbeer zu einem skurrilen, ja ironischen Symbol, bar jeder Heiligkeit. Arkmann hat diese Komposition eigens für das Ensemble La Mandorle geschrieben.
Vivaldis Triosonate (RV 820) interpretieren wir als wahres musikalisches Turnier! Der Lorbeer, ein Symbol des Ruhms, wurde historisch mit militärischen Siegen in Verbindung gebracht. Wem wird die Lorbeerkrone angeboten?
Das Programm wird fortgesetzt mit Robert de Visées Suite in a-Moll, die wir rekonstruiert haben. Als Lautenist am Hofe Ludwigs des XIV. verkörpert er die Eleganz intimer Salonmusik – das historische Gegenstück zu dem zeitgenössischen Stück, das wir zuvor spielen. Der Lorbeer könnte die Ehrerbietung darstellen, die Hofmusikern zuteilwurde, die besonderen Schutz genossen. Um dieses Programm stilvoll abzurunden und uns vielleicht auf unseren Lorbeeren auszuruhen, spielen wir eine typische Händel-Triosonate (op. 2, Nr. 5), in der die Oboe der Violine gegenübersteht, während das Cello mit seinem hochvirtuosen Part den Ehrenplatz einnimmt.
Wir geben dem Konzert am Ende eine leichtere Note mit einem Kinderreim, in dem der Lorbeer eine subversive Doppelbedeutung hat. Die Zeile „Nous n’irons plus au bois, les lauriers sont coupés“ (Wir gehen nicht mehr in den Wald, die Lorbeeren werden abgeschnitten) ist nicht so harmlos, wie sie scheint. Im Frankreich des 17. Jahrhunderts hängten Bordelle einen Lorbeerzweig über ihre Türen, doch Ludwig XIV. beschloss, Prostitution unter Strafe zu stellen. Der Ursprung dieses Liedes scheint später zu liegen, geschrieben von Madame de Pompadour, die damit gegen die Schließung dieser Bordelle protestieren wollte.
Eröffnet wird das Preisträgerkonzert durch einen zusätzlichen Beitrag des Yara Ensembles, das in der „göttingen händel competition“ 2025 mit dem Sonderpreis „Musik und Raum“ ausgezeichnet worden ist. Es spielt die selten zu hörende Partia VI von Heinrich Ignaz Franz Biber. Zentrum dieses Werkes sind 13 Variationen über eine Aria aus zweimal vier Takten. Obwohl in den einzelnen Variationen das Thema und dessen harmonische Struktur streng beibehalten sind, werden der musikalische Gestus, die technischen Anforderungen und der Kompositionsstil stark verändert. Es finden sich frühbarocke Diminutionssätze, Abschnitte im Consortstil und hochvirtuose Passagen, die in ihrer Konsequenz beinahe an Etüden erinnern. Dabei erfüllt jede Variation eine feste und eigenständige Aufgabe in der Darstellung oder dem Training der Virtuosität: sowohl im technischen Bereich (etwa in Diminutionen oder Doppelgriffen) als auch im Bereich des kammermusikalischen Zusammenspiels oder im Bereich der Präsentation kompositorischer Künste.